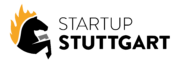WANN: 22. Juli 2014, 9:30–11:30 Uhr
WO: Technologiezentrum der Universität Stuttgart , Nobelstraße 15, 70569 Stuttgart
Organisiert durch das TTI der Universität Stuttgart
Referenten:
Jenny Hubertus und Dr. Carsten Ulbricht von der Kanzlei Bartsch Rechtsanwälte
Neben ihrer Anwaltstätigkeit ist Jenny Hubertus als Referentin im Bereich des Internetrechts und der Sozialen Medien für verschiedene Veranstalter tätig. Dr. Carsten Ulbricht veröffentlicht regelmäßig Artikel und Aufsätze zu Rechtsfragen im Bereich des IT-, Internet- und Datenschutzrechts in seinem Blog „Internet, Social Media & Recht“ unter www.rechtzweinull.de und zahlreichen weiteren Fachmedien und Zeitschriften.
Zielgruppe:
- Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
- Alumni & Gründungsinteressierte aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen
- Gründer/innen und junge Unternehmen
Bitte melden Sie sich bis 15.07.2014 per E-Mail edith.schmitt[at]tti-stuttgart.de mit dem Stichwort „Recht“ an.