„Awesome!“ Für diese Wort gibt es heutzutage eine passende deutsche Übersetzung: „Geil!“ Dies ist das Adjektiv für das meiste, was in der deutschen Startup-Kultur entwickelt wird. Ganz nach kalifornischen Vorbild, wo gedämpfte Euphorie schon fast als Beleidigung gilt. Ob es nun die App ist, die irgendwelche Lieferzeiten abkürzt oder das neueste Projekt der „sharing economy“. „Geil“ ist erst einmal alles. Die typisch amerikanische, ungebremste Begeisterungsfähigkeit ist in der Tat ein Schlüssel dazu, warum neue Ideen in den USA häufig bessere Chancen haben als bei uns. Es ist deshalb ein gutes Zeichen, wenn allmählich ein wenig von diesem „Awesome“ in die deutsche Bedenkenträgerkultur hineinsickert. Gründer, insbesondere jüngere, können sich über ihr medial vermitteltes Image in Deutschland zurzeit nicht beklagen. Vom Wirtschaftsmagazin über die seriöse Tageszeitung bis zum privaten Unterhaltungskanal gelten sie als cool. Und so manche Idee, die kaum den ersten „Pitch“ bei einem kühl kalkuierenden Investor überstehen würde, ist ersteinmal – nun ja – „echt geil.“ Das nette Image vom fröhlichen Gründer wird von sympathischen Ritualen und Praktiken befördert. Man duzt sich sofort und ungefragt. Jeder redet mit jedem. Netzwerken ist der Schlüssel. Die Startup-Kultur kann geradezu zum Lifestyle werden. Als für den Lebenslauf cooler Abschnitt der eigenen Biografie zum Beispiel. Und angesichts der Vielzahl an Förderwettbewerben, Preisverleihungen und Prämierungen ist die Karriere als netter, öffentlichkeitswirksamer Gründer fast schon eine Laufbahn für sich. Ob daraus dann wirklich nachhaltige Geschäftsmodelle oder gar große, weltbewegende Ideen werden, ist die andere Frage. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber deutsche Gründungen pendeln sich immer noch häufig in einer „comfort zone“ mittlerer Größe ein, ohne das ganz große Rad drehen zu wollen, wie das die Visionäre aus den USA auszeichnet.
Die optimistische US-Gründerkultur hat eine Kehrseite
Bei der Begeisterung über den aus den USA importierten locker-optimistischen Ton geht nämlich die andere Seite dieses Modells oft unter: Hinter dem Lächeln versteckt sich eine knallharte, bis auf die Knochen kapitalistische Philosophie. Der Investor, der einem gerade noch auf die Schultern klopfte, macht einem eine Minute später ganz kühl klar, dass er keinen Pfifferling auf die mit Herzblut vorgestellte Idee wetten will. Und alle Massagestühle und alle kostenlosen Pizzalieferungen in den Büros können nicht kaschieren, dass bis an die Grenze geschuftet wird – und manchmal darüber hinaus. Die US-Gründerkultur ist nur oberflächlich „nett“. Sie akzeptiert gleichzeitig auch die gnadenlosen Gesetze des Marktes. Es birgt also ein gewisses Risiko, wenn in Deutschland das Bild einer neuen jung-dynamischen Startup-Kultur für die breite Öffentlichkeit zu viel Nettigkeit transportiert. Um nicht falsch verstanden zu werden: Auch in deutschen Startups wird knallhart am Erfolg gearbeitet – aber der Schritt zur echten Größe bedeutet eben auch, über die sympathischen Gepflogenheiten der Anfangsjahre hinauszuwachsen. Es sind nicht nur die sich ironischerweise „business angels“ nennenden Investoren, die von außen für harte Enscheidungen zuständig sind, sondern auch zum Unternehmer gereifte Gründer selbst. Es ist knochenhart, einem Mitgründer aus den Anfangsjahren zu sagen, dass er für eine größer gewordene Firma vielleicht nicht mehr der Richtige ist. Es ist bitter, vielleicht einmal Menschen entlassen zu müssen, weil sie nicht die nötige Leistung bringen. Man braucht nicht gleich, wie es bei US-Unternehmen wie Amazon leider passiert, unmenschlich zu handeln. Aber wer sich in dem System bewegt, das wir hierzulande lieber als Marktwirtschaft bezeichnen denn als Kapitalismus, kommt um Härten nicht herum. Und dann muss man damit leben, dass einen nicht mehr alle Welt sympathisch und „geil“ findet.
Bei zu viel Erfolg dreht sich in Deutschland der Wind
Während Startups in der Frühphase in Deutschland inzwischen verwöhnt davon sind, dass sie medial gelobt und gepampert werden, dreht sich an einem bestimmten Punkt der Wind. Auf einmal findet einen dann die Öffentlichkeit gar nicht mehr so nett. Wer wirklich groß werden will, der hat es hierzulande weiterhin schwer. Das haben etwa die Gebrüder Samwer erfahren, als sie das ganz große Rad zu drehen begannen. (Knallharte Burschen, die auch scharfe Kritik gefälligst auszuhalten haben, sind sie übrigens wirklich.) Nette, junge Gründer mögen wir in Deutschland schon – aber auch jemanden, der nach dem ganz großen Erfolg greift? Um nicht missverstanden zu werden: Welche Balance jeder sucht, ist seine eigene Entscheidung. Klein, aber glücklich zu sein kann besser sein als Welteroberer zu werden und zynisch. Was aber nötig wäre, ist mehr Ehrlichkeit. Das kann manchmal auch weh tun. Ich habe schon am eigenen Leib erlebt, wie frisch gebackene Gründer, die an sympathisierende Berichterstattung gewöhnt sind, sich darüber wundern, wenn ich nicht mehr alles nur toll finde. Und nach einer gewissen Zeit im Stuttgarter Gründerbiotop beginne ich zu ahnen, dass nicht immer und an allen Punkten hier alle eine große Familie sind. Jeder hat sein Ego, jeder hat Interessen – und ich halte das nicht nur für legitim, sondern auch für produktiv. In den wichtigen Dingen an einem Strang ziehen, sich ansonsten ehrlich zu streiten, ist das richtige Rezept. Aber dafür braucht es auch den Mut, das oberflächliche Image von der netten Gründerfamilie durch andere, realistische Facetten zu ersetzen. Es gibt Kooperation, aber auch Konkurrenz. Wer geschäftlichen Erfolg haben will, kann nicht immer nur ein Idealist sein. Zur Gründerkultur gehört die Fähigkeit zu harten, konsequenten Entscheidungen. Ein Element, der US-Mentalität, das mich immer wieder beeindruckt hat, kann man dabei gerne übernehmen: Amerikaner können auch nach einer knallharten geschäftlichen Auseinandersetzung anschließend ganz locker ein Bier zusammen miteinander trinken, weil sie die Dinge auseinanderhalten und nicht alles persönlich nehmen. In diesem Sinne: Seid nett zueinander!
______
Bildquelle: Selena N.B.H. unter CC-Lizenz CC BY 2.0
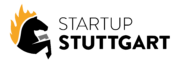



Ja, Gründer müssen nett und aufrichtig sein.
Auch ich würde mir deutlich mehr “Mit dem Kopf durch die Wand”-Typen wünschen. Die können trotzdem nett sein – das ist kein Widerspruch.
Die Samwers sollte man nicht als Vorbild betrachten. Denn es wird die falsche Schlussfolgerung gezogen: nur wer die Schwachen (Klingeltöne an Kinder verkaufen) ausnutzt, kann erfolgreich sein.
Es sollte Motivation sein, das Gegenteil zu beweisen.